11.09.20
Der verlassene Osten
Ich bin Mitte Dreißig und komme aus Ostdeutschland. Das ist soweit erstmal nichts Besonderes, jedoch meine ich, dass meine Generation einfach nicht genug Gehör findet.
Von Leonore.
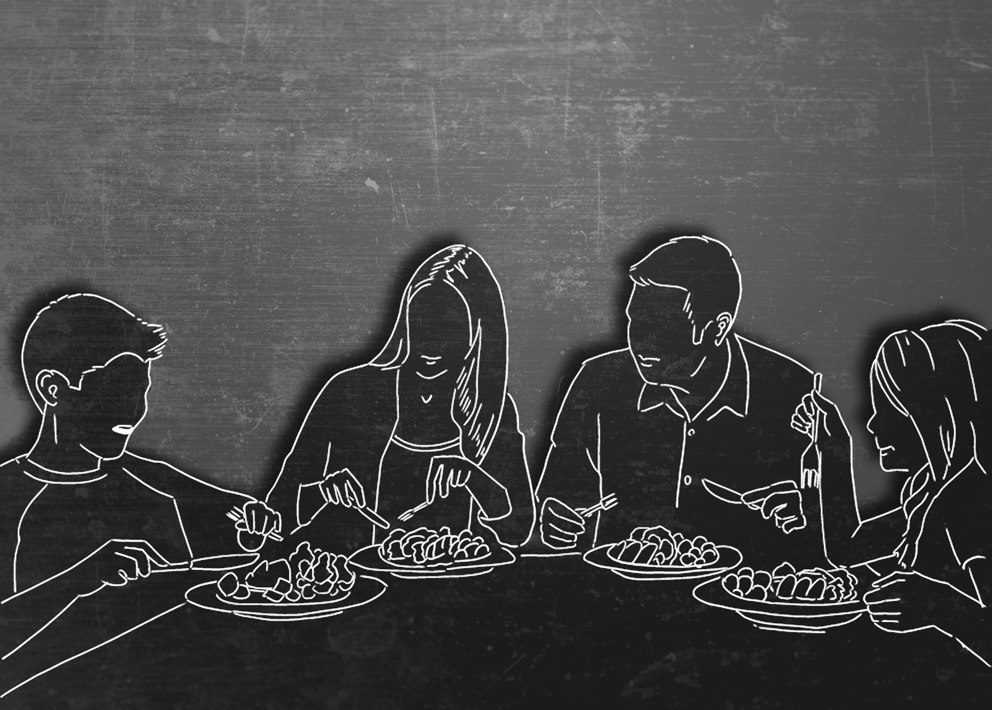
Nachrichten und Kritik
11.09.20
Ich bin Mitte Dreißig und komme aus Ostdeutschland. Das ist soweit erstmal nichts Besonderes, jedoch meine ich, dass meine Generation einfach nicht genug Gehör findet.
Von Leonore.
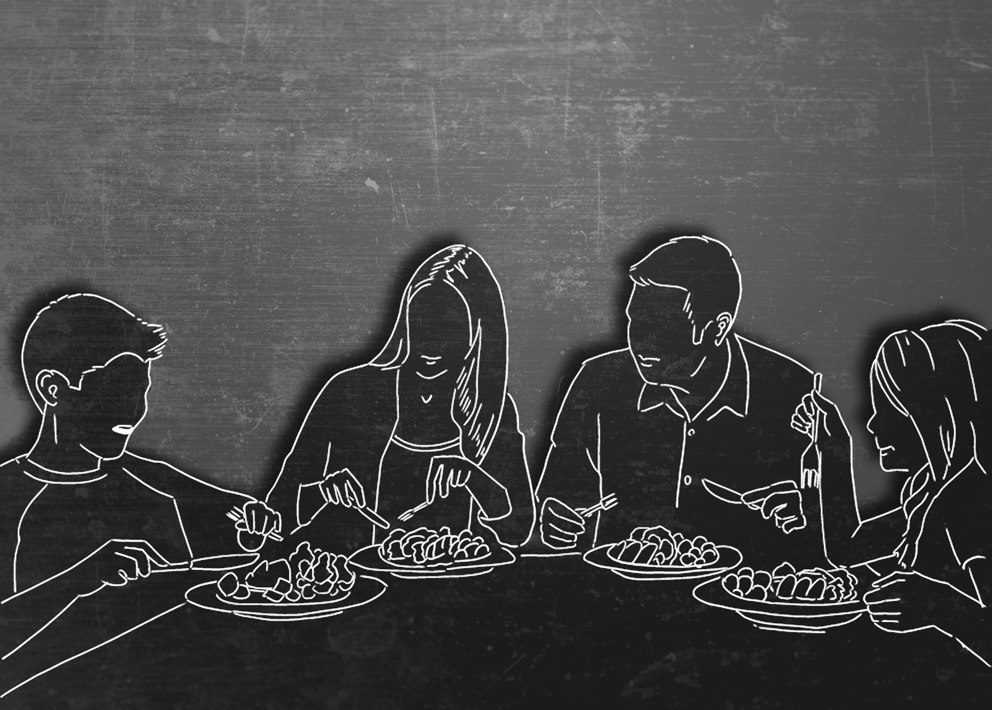
Was macht sie so erwähnenswert? Das sind die vielen kleinen Dinge, die uns vom Rest der Republik irgendwie unterscheiden. Da ist z.B. die Sozialisierung, dass Verständnis davon, dass man auch als Frau locker in einem technischen Beruf mithalten kann. Dass man selbst für seinen Lebensunterhalt sorgt, nicht heiratet, um versorgt zu sein. Da gab es mal ein liberales Abtreibungsrecht und einfache Scheidungsmöglichkeiten, das hat uns Frauen ein anderes Selbstverständnis vom Leben mitgegeben.
Natürlich haben auch die Frauen aus dem Osten im Grunde ähnliche patriarchale Prägungen wie die Frauen aus dem Westen: der Mann hatte auch in der DDR Zuhause ein entspanntes Leben und Frauen waren in Führungsetagen genauso Mangelware wie Bananen im Konsum.
Zeitsprung. Heute sind wir vereint, zumindest auf dem Papier. In den Köpfen eher nicht so. Es gibt einige Dinge, die den Osten und den Westen trennen. Hervorheben möchte ich den zunehmenden Rechtspopulismus und das Liebäugeln mit Faschisten. Warum ist das so?
In meiner Jugend, die vom Wendegeschehen geprägt war, gab es eigentlich nichts, was uns Kinder aufgefangen hätte. Die Eltern arbeitslos, die Jugendclubs geschlossen, es gab kein Geld für SozialarbeiterInnen oder Angebote nach der Schule. So hingen wir mehrheitlich herum, an Haltestellen und an Supermärkten. Die Tristesse sollte einen positiven Anklang bekommen, und so schwiegen wir unsere Fragen aus und wandten uns dem zu, was uns eben blieb. Drogen, Alkoholekzesse, Diebstähle. Ich hatte in meiner Schullaufbahn einige Schulversager kennengelernt, haltlose junge Menschen, das Elternhaus marode, die Sozialprognosen schlecht. Der erste Schulabgänger beendete seine Laufbahn bereits in der siebenten Klasse, zuoft sitzen geblieben, herumgereicht von einer Einrichtung zur nächsten, ohne Aussicht auf Besserung. So war es jedes Schuljahr, immer ein paar dazwischen, die mindestens zwei oder drei Jahre älter waren als ich selbst. Jedes Schuljahr neu war auch die politische Gesinnung meiner KlassenkameradInnen. Im achten Jahr waren von 24 SchülerInnen 22 selbsternannte Nazis. Sie hörten Landser und „kloppten“ in ihrer Freizeit gern VietnamesInnen und alle Menschen, die einen migrantischen Hintergrund zu haben schienen. Es galt als „in“, es war eine Form der Rebellion, es war die Suche nach einer Heimat, einer Familie. Die Menschen, die ein paar Jahre vor mir in die Wende hineingeboren wurden, hat es noch härter getroffen. Mitten in der Pubertät ein solcher Umsturz, ein Trauma in den Familien, das bis heute wirkt. Und das Leben von vielen nachhaltig aus der Bahn warf. Das Neonazitum war am Erstarken, die Ereignisse, die Brutalität und Angriffe auf ausländische Bürger wurden als Jugendstreich und Prügelei abgetan und gar nicht thematisiert. Überhaupt niemand thematisierte den plötzlichen und massenhaften Rechtsruck. Es war, als gäbe es uns überhaupt nicht. Zuhause, da waren die Eltern, überfordert mit der Situation, arm, arbeitslos. Ich bin selbst in Armut aufgewachsen, mein Vater war Alleinverdiener, er war nie da. So ging es vielen meiner FreundInnen. Die Lehrer bemühten sich, den Anforderungen an das neue System Genüge zu tun- und für uns? Für uns blieb kein Platz. Die restlichen Schuljahre vergingen schnell, aufs Gymnasium durfte ich nicht, denn das war zu teuer. Wenn ich heute Bilder aus meiner Jugend sehe, schäme ich mich. Die übergroßen, abgetragenen Klamotten meiner Schwester, niemand auf diesen Bildern lächelt je. Ostern, Weihnachten, Geburtstag: es gibt kein Bild auf dem irgendjemand in meiner Familie unbeschwert aussieht, alle haben Sorgenfalten, traurige Blicke starren ins Nichts.
Und ich war nicht alleine. Ich besuchte oft meine beste Freundin zuhause, deren Mutter bulimie- und alkoholkrank war. Psychische Krankheiten gab es in der DDR zwar, aber sie wurden tabuisiert und totgeschwiegen. Und als ich selbst magersüchtig wurde, taten alle in meiner Familie das, was sie gelernt hatten: sie schwiegen es aus, denn was man nicht thematisiert, ist auch nicht da. Von der kleinen Familie bis zur ganzen Gesellschaft: die Kultur des Wegsehens und der Hilflosigkeit, aber auch des Unmuts und der Unzufriedenheit, stifteten ein Klima, dessen Auswüchse wir heute sehen können: im Erstarken der AfD, im Rechtsruck, in den Verschwörungstheorien.
Viele AfD-Wähler sind in meinem Alter. Sie sind männlich, kommen aus dem Osten, verdienen unterdurchschnittlich und sehen keine Perspektive. Die haben sie noch nie gesehen. Ich will diese Leute nicht in Schutz nehmen. Doch dies ist eine Erklärung dafür, warum wir heute in dieser Situation leben. Das Wegsehen, das hat sich im Osten etabliert. Dies alles sind Gründe, warum im Osten der Rechtspopulismus so salonfähig ist. Es ist höchste Zeit, die Jugend von damals als Beispiel zu nehmen, wie gemeinschaftliches Wegsehen die Zukunft völlig ruinieren kann. Allein, damit sich das nicht wiederholt, lohnt es sich, dieses Thema anzugehen.
Es ist bekannt, dass Menschen selten aus ihrem eingeborenen Status ausbrechen. Wenn jetzt nichts geschieht, wird sich dieser Kreislauf nur schwer durchbrechen lassen. Ich habe meine Heimat längst verlassen, wie viele Frauen und möchte nie mehr zurückkehren. Ich habe mein Abitur nachgeholt und studiert, ich möchte nicht, dass meine Kinder dasselbe erleben wie ich. Doch ich weiß, dass nicht alle das schaffen können. Und damit sich das nicht wiederholt: seht hin, und setzt euch ein für gute Freizeitbetreuung und ausreichend soziale Angebote. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Geschichte wiederholt.